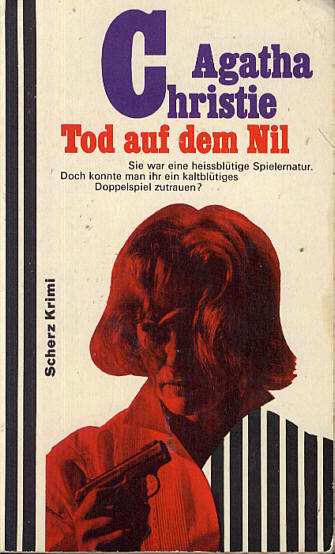In einem Hotel hört Hercule Poirot den Satz: "Du sieht doch ein, daß sie umgebracht werden muß". Er kann das Schicksal in seinem Lauf nicht aufhalten, aber er kann den Mörder finden.
Verfilmt mit Peter Ustinov.
Als ich das Buch (im Jahr 2009) wieder las, hab ich tatsächlich den Film darin nicht wiedererkannt. Das liegt vor allem daran, daß Mrs. Boynton im Buch sehr viel von Jabba the Hut hat und gleichzeitig etwas von einem Jedi-Ritter. Sie ist fett und fast unbeweglich, manipuliert ihre Familie jedoch, in dem sie ihnen einfach Vorschriften macht, die diese wie hypnotisiert wiederholen und sofort ausführen.
Die Lösung des Buches ist gut versteckt. Um ehrlich zu sein: Ich hatte eine viel literarische Lösung erwartet, immerhin war angedeutet worden, daß sie eine Haushaltshilfe zerstört hat, in dem sie sie schwanger aus dem Haus warf, kurz danach wurde mitgeteilt, daß eben die von mir verdächtigte Figur bei einer Tante aufgewachsen ist. Ganz beiläufig, so daß man es kaum merkt. Entweder ein ganz hervorragendes Ablenkungsmanöver oder ein Rest eines letztendlich verworfenen Endes.
Poirot taucht ganz am Anfang auf, verschwindet dann für die erste Hälfte des Buches und beherrscht es im zweiten Teil.
Oberst Race wird erwähnt, ebenso der
Mord im Orient-Express und die
ABC-Morde.
Bei der Auflage von 1984 handelt es sich um eine Neuübersetzung.
Ups. Das kommt davon, wenn man den Roman mehrfach hat. Ich habe die Neuübersetzung 2017 erneut gelesen.
Nein, das Buch gehört nicht zu den stärksten Romanen Christies, was ganz einfach daran liegt, daß Poirot bestenfalls eine Nebenrolle spielt.
Familie Boynton, deren Oberhaupt die fette Ex-Gefängniswärterin war, ist von ihrem Aufbau her recht interessant, wenn auch nicht ganz glaubhaft. Ich kann mir vorstellen, daß ein Mensch völlig unter der Kontrolle eines anderes steht, aber hier haben wir es mit vier Personen zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es eine Familie mit einer solchen Konstellation gäbe, käme es zu Fraktionsbildungen und wenigstens eine Person würde gegen das Schreckensregime aufbegehren.
Auch beim jetzigen Lesen hatte ich am Ende das Gefühl, daß Christie Erzählstränge begonnen hat, die ins Nichts führen. Man kann natürlich behaupten, das diene nur dazu den Leser zu verwirren. Möglich. Aber für wahrscheinlicher halte ich, daß Christie ursprünglich eine etwas komplizierte Lösung plante, die sie dann verworfen hat, nachdem Poirot eh bei der Auflösung im Nebel stochert.
Es handelt sich um Christies 23. Roman, der erstmals am 02.05.1938 veröffentlicht wurden, nachdem er vorher (1937) in einer amerikanischen Zeitschrift in Fortsetzungen erschien (Collier's Weekly 20.08. - 23.10 1937). Erst danach erschien die Geschichte in England (Daily Mail 19.01.-19.02.38) Allerdings war diese Erstfassung gekürzt.
Wie man sich denken kann, sind die Ausflüge und Reisen von eigenen Erfahrungen mit ihrem zweiten Ehemann beeinflusst.
Die Verfilmung mit David Suchet ist eine Enttäuschung - aber nicht seinetwegen. Vielmehr ist es das Drehbuch, das sich an viel zu vielen Punkten von der Vorlage entfernt. Eine verpasste Chance, wirklich. Da hat man eine Idealbesetzung und vergeigt es, weil man glaubt, es besser als Agatha Christie machen zu können.
Unverständlich.
Der Beginn des Romans:
| Agatha Christie (zitiert nach der englischsprachigen Wikipedia |
Scherz (1976) |
Ursula Gail (Scherz 1984) |
| "You do see, don't you, that she's got to be killed?" |
"Du siehst doch ein, daß sie umgebracht werden muß, nicht?" |
"Und du? Du denkst doch auch, daß sie am besten tot wäre!" |
Auf der ersten Seite wird in der alten Übersetzung wird Trollope als "Anthony Trollope, der berühmte Romanschriftsteller" bezeichnet. Bei Gail ist von irgendeinem englischen Schriftsteller die Rede, der im nächsten Satz als Trollope ohne Vornamen genannt wird. Wikipedia nennt zwei Trollopes, die Christie gekannt haben könnte. Einer heißt - Anthony.
Interessant ist ein Vergleich des Schlusses in den Übersetzungen:
| Scherz (1976) |
Ursula Gail (Scherz 1984) |
Ihre Stimme ging leise, fast ohne Pause, in die Zeilen von Cymbeline über, deren Musik die anderen wie gebannt lauschten:
Fürchte nicht mehr Sonnenglut,
Noch des grimmen Winters Hohn!
Jetzt dein irdisch Treiben ruht,
Bist daheim und hast den Lohn ...
|
Nach einer kaum spürbaren Pause zitierte sie leise eine Strophe aus "Cymbeline". Die anderen lauschten wie verzaubert.
"Fürchte nicht mehr Sonnenglut
Noch des Winters grimmen Hohn!
Jetzt dein irdisch Treiben ruht,
Heim gehst, nahmst den Tageslohn." |
Cymbeline ist einerseits der Titel eines Stücks von
Shakespeare, andererseits der Name des Hauptdarstellers.
Gail folgt der Übersetzung von Dorothea Tieck (aus dem Jahr 1833), während der Erstübersetzer näher an Shakespeare ist. Bei dem englischen Barden heißt es:
Fear no more the heat o' the sun,
Nor the furious winter's rages;
Thou thy worldly task hast done,
Home art gone, and ta'en thy wages:
Golden lads and girls all must,
As chimney-sweepers, come to dust.
Zum einen geht es also in Zeile zwei um eine Eigenschaft des Winters, nicht des Hohns, zum anderen sind die Auslassungspunkte korrekt, denn das Zitat endet an dieser Stelle eigentlich nicht.